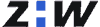
 |
|
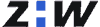 |
|
Abteilung Informatik, Kommunikation und Elektrotechnik | |||
Mechatronische Systeme
![]() Antrieb mit Switched-Reluctance-Motor für Elektrofahrrad
Antrieb mit Switched-Reluctance-Motor für Elektrofahrrad
| Student: | Albrecht Rene | |||||
| Fischer Matthias | ||||||
| Dozent: | Brom Bruno-Charles Prof. | |||||
| Kurzbeschreibung: | ||||||
|
Auf dem Markt erscheinen in letzter Zeit immer mehr Elektrofahrräder mit fest eingebautem Motor. Das von uns zu entwickelnde Power-Wheel beruht auf einem anderen Konzept. Die Idee dahinter ist, dass der Elektromotor in das Hinterrad integriert wird. Durch dieses System kann sich der Besitzer zwischen Elektrofahrrad und gewöhnlichem Mountainbike entscheiden. Der Umbau geschieht, indem das Hinterrad mit dem Power-Wheel ausgetauscht wird. Das Ziel der Diplomarbeit war es, abzuklären, ob das Power-Wheel mit einem geschalteten Reluktanzmotor nach Transversalflussprinzip realisiert werden kann und gegebenenfalls ein Modell zu entwickeln. Dabei bauten wir auf der Projektarbeit II/99 "SRM-Power-Wheel" auf. Mit den Ergebnissen der daraus folgenden Abklärungen konnte ein mathematisches Modell hergeleitet werden, mit dem wir das Verhalten des Power-Wheel simuliert haben. Mit diesem Modell haben wir die Anforderungen überprüft. Im Verlauf der Diplomarbeit stellte sich heraus, dass das Pflichtenheft mit einem SR-Motor nicht erfüllt werden kann. Die Simulationen ergaben, dass der Motor zweisträngig ausgelegt werden müsste, um die Anforderungen auch nur annähernd zu erfüllen. Das Hauptproblem liegt in der Anstiegszeit des Stromes bei hohen Geschwindigkeiten. Der Grund ist die hohe Ankerinduktivität. Zusätzlich sind die Umdrehungsgeschwindigkeiten des Motors verhältnismässig klein. So werden pro Pol grosse Kräfte benötigt. Mit diesen Einschränkungen ist die geforderte Unterstützung von 100 % der aufgewendeten Kraft nur noch bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h, anstelle der geforderten 35 km/h, gegeben. Das Gewicht steigt durch den zusätzlichen Strang auf 12.5 kg an.
Im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Elektrofahrrädern schneidet das Power-Wheel schlechter ab und wird so wohl nie produziert werden. |
||||||
![]() Bahnsteuerung für Betonförderpumpen
Bahnsteuerung für Betonförderpumpen
| Student: | Jucker Roland | |||||
| Dozent: | Brom Bruno-Charles Prof. | |||||
| Kurzbeschreibung: | ||||||
|
Mobile Betonförderpumpen verfügen über ein Rohrsystem, durch welches der Beton an seinen Bestimmungsort gepumpt wird. Die Förderleitung wird von einem Mast getragen, der um die vertikale Achse schwenkbar ist und aus einzelnen Armen besteht. Diese Arme sind durch Gelenke miteinander verbunden, so dass durch Verändern der einzelnen Gelenkwinkel und Drehen des ganzen Verteilmastes das Ende des Rohrsystems beliebig positioniert werden kann. Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, eine Steuerung zu entwickeln, welche es erlaubt, die Position des Rohrendes in einer gewünschten Bahn zu bewegen, ohne dafür jedes Gelenk einzeln steuern zu müssen. Die Gelenkwinkel sollen von der Steuerung vorgegeben werden, während an der Bedienungseinheit nur die gewünschte Richtung und Geschwindigkeit des Rohrendes eingestellt wird. Mit einer Computersimulation des Verteilmastes kann die Steuerung demonstriert werden.
Die Steuerung ermittelt aus den aktuellen Winkeln und den Steuerbefehlen die Winkel für die neue Position des Rohrendes. Dazu werden geometrische Überlegungen sowie kinematische Berechnungen verwendet. Diese Winkel werden nun dem Positionsregler als Sollwert übergeben und so das virtuelle Modell der Sollposition nachgeführt. Der simulierte Verteilmast gibt die Winkel-Istwerte zurück. In der Berechnung der Winkel-Sollwerte muss ausserdem sichergestellt werden, dass Positionsvorgaben abgefangen und entsprechend korrigiert werden, wenn sie von der mechanischen Konstruktion her nicht zulässig sind. Die gesamte Steuerung wurde mit MATLAB/SIMULINK realisiert und der virtuelle Verteilmast in ADAMS modelliert. Die Simulation läuft in SIMULINK ab, wobei jedoch für die Darstellung und Animation des Modells ADAMS automatisch aufgerufen wird. |
||||||
![]() Numerische Modellierung einer induktiven Streckrollenheizung
Numerische Modellierung einer induktiven Streckrollenheizung
| Student: | Ledergerber Guido | |||||
| Dozent: | Roos Markus Dr. | |||||
| Kurzbeschreibung: | ||||||
|
Die Firma Rieter AG stellt sogenannte Streckrollen her, welche für die Garnherstellung benötigt werden. Im Innern der Streckrolle erzeugt ein Induktor einen zeitlich variierenden magnetischen Fluss, der im Stahlzylinder der Streckrolle durch Wirbelströme Wärme erzeugt. Frisch gesponnene Garnfäden laufen über diese geheizten, schnell rotierenden Stahlzylinder. Durch genaue Kontrolle der Zylindertemperaturen verbunden mit einem flachen Temperaturprofil auf der Streckrollenoberfläche erreicht man gleichbleibende Fadenqualität. Durch die frühere Zusammenarbeit der NM GmbH und Rieter AG bestand ein erstes grobes numerisches Finite Elemente Modell der Streckrolle. Dabei wurde die Software SESES benützt um dieses Modell zu erstellen. Ziel dieser Diplomarbeit war eine Weiterentwicklung des bereits bestehenden numerischen Modells zur Berechnung dieser Streckrollen. Die Hauptaufgabe bestand darin, das numerische Modell anhand von Messresultaten, soweit zu optimieren, dass die Berechnungen der Temperatur in der Streckrolle möglichst gut mit den Messdaten übereinstimmen. Nachdem der Einfluss von verschiedenen Parametern auf das Temperaturverhalten und die benötigte Heizleistung der Streckrolle bekannt war, konnten die verschiedenen Parameter eingestellt werden. Es konnte erreicht werden, dass sowohl die Heizleistung wie auch die Temperaturen der Streckrollen gut mit den Messdaten übereinstimmten. Die Aufgaben, die bisher nur zylindrisch gewickelte Spule durch die sogenannte Knochenform zu erweitern und das Modell um die zusätzliche Fadenlast zu ergänzen, konnten gelöst werden. Das jetzige Modell kann nun eingesetzt werden für die Entwicklung von neuen Streckrollen. Mittels zusätzlicher Messdaten liesse sich das bestehende Modell jedoch noch weiter optimieren.
Die weiteren Aufgabenpunkte Temperaturregelung und Empfindlichkeit bezüglich Materialdaten und Geometrietoleranzen konnten nicht bearbeitet werden, da die anderen Aufgaben zuviel Zeit beanspruchten. |
||||||
![]() Entwicklung Magnetkreis basierter Steuerknüppel
Entwicklung Magnetkreis basierter Steuerknüppel
| Student: | Innerhofer Guido | |||||
| Dozent: | Schwarzenbach Hansueli Prof. Dr. | |||||
| Kurzbeschreibung: | ||||||
|
Die Firma Genge & Thoma AG in Lengnau bei Biel, ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Steuerknüppeln. Diese Firma ist daran, den Aufbau dieser Knüppel zu verbessern. Sie will mit Hilfe magnetischer Kreise berührungsfrei, das heisst unter Verzicht auf verschleissanfällige Schleifkontakte, die Auslenkung der Steuerknüppel feststellen. Diese Aufgabe wurde in einer früheren Arbeit bereits untersucht. Als neue Eigenschaft dieser Joysticks möchte man die Nullstellung oder Ruhestellung ebenfalls mit Hilfe eines magnetischen Kreises und eines Sensors feststellen können. Aus diesem Grund war es die Aufgabe dieser Arbeit, das Induktionsfeld unterhalb der Eisenkugel und die allfällige Vergrösserung des Gradienten durch Einfügen von zusätzlichen Materialkomponenten zu untersuchen. Um diese Aufgabe zu lösen verwendete ich die von der Firma NM GmbH entwickelte Software SESES. Mit diesem Programm war es möglich ein dreidimensionales Modell aufzubauen, welches aus vielen kleinen Maschen besteht. Nach der Festlegung bestimmter Parameter und Materialeigenschaften konnte das Modell mit Hilfe von finiten Elementen simuliert werden. Aus den ersten Simulationen ergab sich die Erkenntnis, dass die Induktion unterhalb der Kugel etwa dreimal kleiner ist als zwischen der Kugel und den Polschuhen. Jedoch ist die Änderung des Feldes zu klein um von dem verwendeten Sensor festgestellt zu werden.
In einem nächsten Schritt entwickelte ich verschiedene Möglichkeiten um die Feldänderung bei kleinen Auslenkwinkeln des Steuerknüppels zu vergrössern. Auch untersuchte ich die Auswirkung der Veränderung des Luftspaltes auf das Induktionsfeld. Es kristallisierte sich klar heraus, dass der Vorschlag eines zusätzlichen Eisenstabes unterhalb der Eisenkugel, unter der Voraussetzung, dass er das gleiche Potential hat wie der Nullpotentialkontakt des Systems, die besten Ergebnisse lieferte. Auch kann die Änderung des Induktionsfeldes mit dem vorhandenen Sensor festgestellt werden. |
||||||